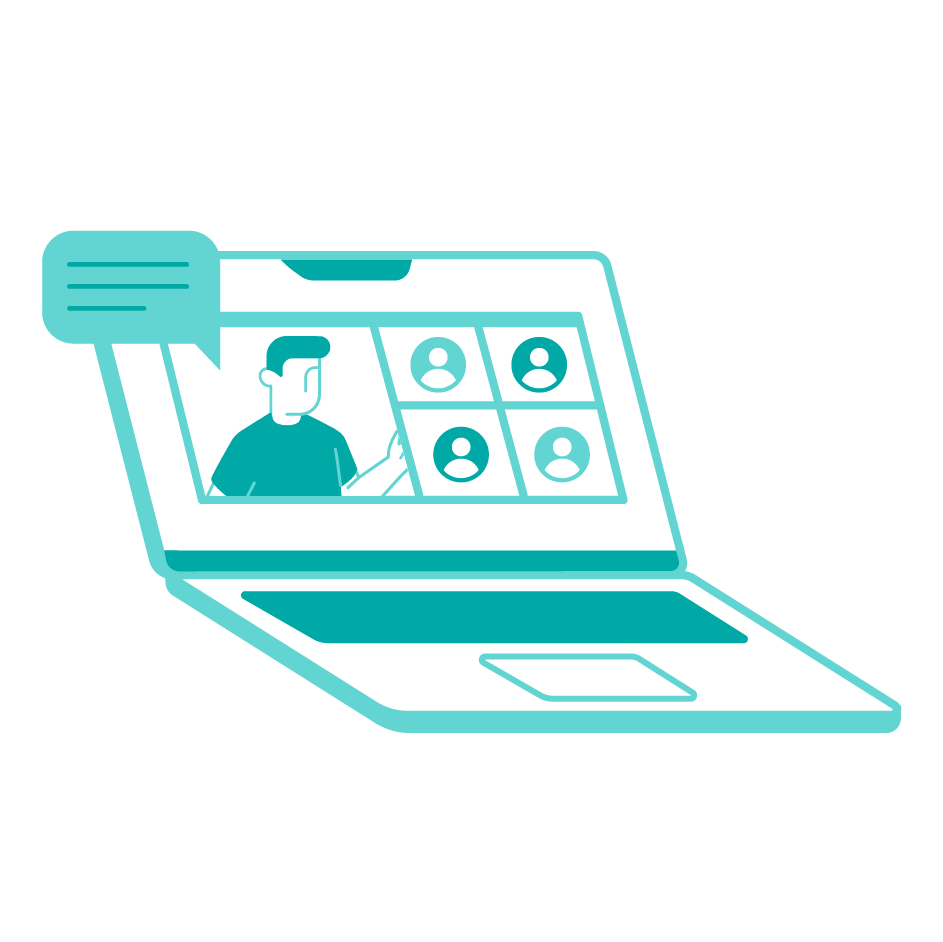Kostenfreie Live-Demo
Jetzt einfach das Formular ausfüllen und Termin aussuchen. Erhalte umgehend eine Bestätigung per E-Mail. Bitte beachte, dass wir die Verfügbarkeit unseres Teams prüfen und uns ggf. mit einem Alternativvorschlag bei dir melden.
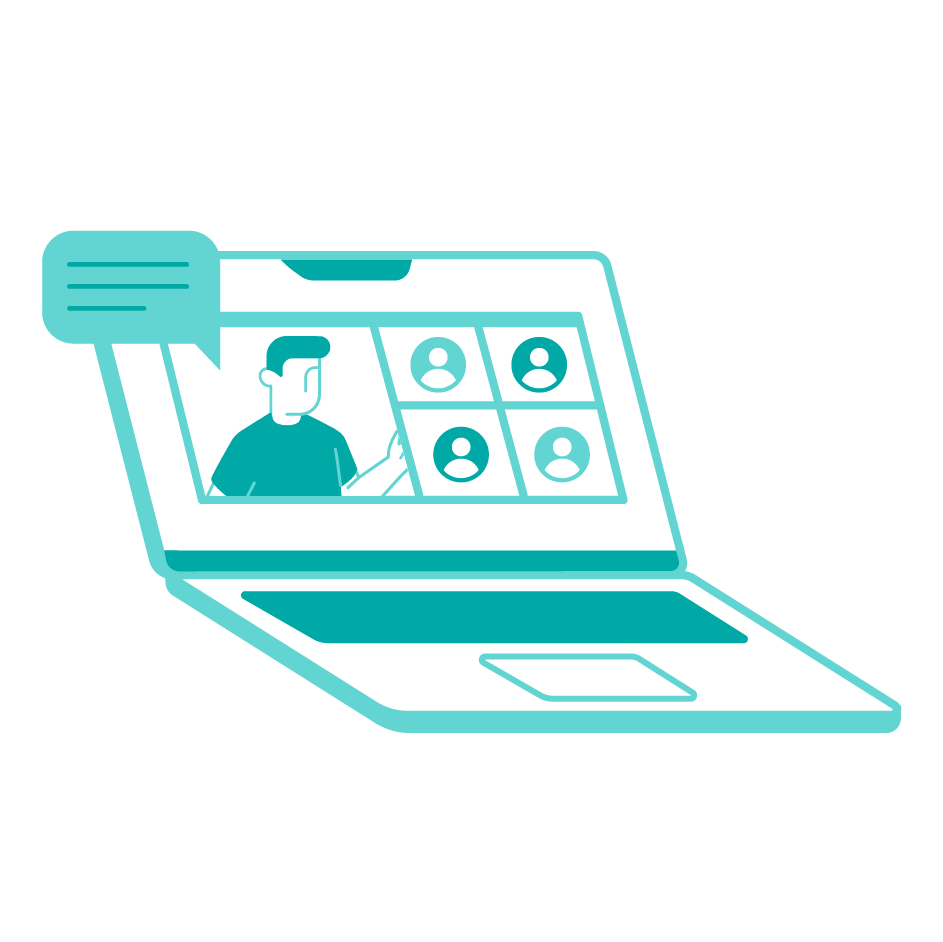

Der § 14c des Energiewirtschaftsgesetzes (EnWG) wurde eingeführt, um Verteilnetzbetreibern (VNB) den Rahmen zu geben, marktgestützte Beschaffung von Flexibilitätsdienstleistungen – also netzdienliche Last- oder Einspeiseveränderungen – für ihr Elektrizitätsverteilernetz zu beschaffen.
Ziel ist es, die Effizienz beim Betrieb und Ausbau der Verteilnetze zu verbessern, indem verfügbare Flexibilitätspotenziale genutzt werden, anstatt ausschließlich auf kostenintensive Netzausbauten oder abrupte Eingriffe (z. B. Abregelungen) zurückzugreifen.
Im Folgenden werden die Pflichten der VNB aus § 14c EnWG, relevante Fristen und Übergangsregelungen, praktische Umsetzungsaspekte, IT-Anforderungen sowie aktuelle Entwicklungen dargestellt. Ein FAQ-Bereich fasst die wichtigsten Fragen und Antworten zusammen.
Verteilnetzbetreiber, die Flexibilitätsdienstleistungen für ihr Netz beschaffen wollen, müssen dies transparent, diskriminierungsfrei und marktgestützt durchführen.
14c Abs. 2 EnWG schreibt vor, dass Beschaffungsspezifikationen so gestaltet sein müssen, dass sich „alle Marktteilnehmer wirksam und diskriminierungsfrei beteiligen können“. Praktisch müssen VNB klare Kriterien und Produkte definieren (etwa wie viel kW Lastreduktion für welche Dauer an welchem Netzknoten benötigt werden) und sicherstellen, dass sowohl große als auch kleine Flex-Anbieter teilnehmen können.
VNB sind verpflichtet, Spezifikationen für die Flexibilitäts-Beschaffungsverfahren und geeignete standardisierte Marktprodukte zu erarbeiten und der Bundesnetzagentur (BNetzA) zur Genehmigung vorzulegen.
Alternativ kann die BNetzA solche Spezifikationen auch von sich aus mittels Festlegung vorgeben. Erst nach Genehmigung dieser Rahmenbedingungen durch die BNetzA darf die eigentliche marktgestützte Beschaffung erfolgen (siehe Fristen unten).
Wichtig ist, dass § 14c EnWG nur zusätzlich zu den bestehenden Eingriffsinstrumenten wirkt. Gesetzlich ist klargestellt, dass die Regelungen der §§ 13, 13a, 14 Abs. 1 und 1c sowie § 14a EnWG unberührt bleiben. Das heißt, Notfallmaßnahmen wie der Eingriff bei Netzengpässen (§§ 13, 13a EnWG) oder die unter § 14a EnWG diskutierte Spitzenglättung steuerbarer Verbraucher (Wallboxen, Wärmepumpen etc.) bleiben bestehen und werden durch § 14c nicht außer Kraft gesetzt.
14c EnWG bietet vielmehr einen ergänzenden Weg: VNB können – ergänzend zum verpflichtenden Redispatch 2.0 – freiwillig Marktmechanismen einsetzen, um Engpässe vorzubeugen oder Netzverstärkung hinauszuzögern.
Die BNetzA hat die Befugnis, Ausnahmen von der Pflicht zur marktgestützten Beschaffung zuzulassen, falls eine Marktbeschaffung „nicht wirtschaftlich effizient ist oder zu schwerwiegenden Marktverzerrungen oder zu stärkeren Engpässen führen würde“.
Die Vorschrift wurde im Rahmen der EnWG-Novelle 2021/2022 in Kraft gesetzt, um EU-rechtliche Vorgaben aus der Strombinnenmarktrichtlinie 2019/944 umzusetzen.
Konkret ist § 14c EnWG zum 29. Juli 2022 in Kraft getreten. Seit diesem Zeitpunkt besteht formal die Möglichkeit für VNB, Flexibilitätsbeschaffung auf Marktbasen durchzuführen, allerdings unter den im Gesetz genannten Bedingungen (Genehmigung von Spezifikationen etc.).
Obwohl § 14c seit 2022 gilt, hat der Gesetzgeber eine Übergangsregelung geschaffen, die die unmittelbare Pflicht der VNB bis auf Weiteres aussetzt. Gemäß § 118 Abs. 28 EnWG „ist die Verpflichtung nach § 14c Absatz 1 für die jeweilige Flexibilitätsdienstleistung ausgesetzt, bis die Bundesnetzagentur hierfür erstmals Spezifikationen […] genehmigt oder […] festgelegt hat“.
Das bedeutet: Solange keine genehmigten oder festgelegten Beschaffungs-Spezifikationen vorliegen, sind VNB (noch) nicht verpflichtet, Flexibilitätsdienstleistungen marktlich zu beschaffen.
Erst wenn entweder ein VNB-Konsortium tragfähige Vorschläge erarbeitet und von der BNetzA absegnen lässt oder die BNetzA selbst aktiv wird, tritt die eigentliche Beschaffungspflicht in Kraft (bundesnetzagentur.de). Diese Übergangsregelung soll sicherstellen, dass VNB nicht ins Blaue hinein unterschiedliche Lösungen entwickeln, sondern ein geordnetes, abgestimmtes Vorgehen erfolgt.
VNB müssen also derzeit noch keine eigenen Marktprozesse umgesetzt haben, dürfen aber freiwillig Pilotprojekte durchführen (siehe unten).
Auch wenn der verpflichtende Startschuss für § 14c EnWG aufgrund der Übergangsregelung noch aussteht, lohnt sich ein Blick darauf, wie die praktische Umsetzung aussehen kann:
Zusammengefasst bietet § 14c EnWG perspektivisch das Instrument eines neuen „Flexibilitätsmarktes“ auf Verteilnetzebene, der präventiv Engpässe entschärfen kann. Die konkrete Umsetzung hängt von noch festzulegenden Rahmenbedingungen ab, die sicherstellen, dass solche Flexmärkte fair, effizient und zuverlässig funktionieren.
Die erfolgreiche Einführung marktgestützter Flexibilitätsbeschaffung stellt hohe Anforderungen an die IT-Infrastruktur der Verteilnetzbetreiber. Insbesondere sind folgende Aspekte relevant:
VNB müssen sicherstellen, dass die Prozesse und Schnittstellen so gestaltet sind, dass Flexibilitätsanbieter ihre Ressourcen im Bedarfsfall zuverlässig aktivieren können. Der VNB stellt das Abrufsignal bzw. den Flexibilitätsbedarf bereit und überwacht die Umsetzung, während die Anlagenbetreiber ihre Anlagen technisch so ausstatten, dass sie nach einem Zuschlag die vereinbarte Flexibilität erbringen können.
Hierfür spielen intelligente Messsysteme (Smart Meter Gateways) und Steuerboxen eine zentrale Rolle. Für § 14c-Anwendungen können diese Infrastrukturen mitgenutzt werden: Über sichere digitale Schnittstellen (z. B. die CLS-Schnittstelle des Smart-Meter-Gateways) kann ein VNB oder ein beauftragter Dienstleister Schaltbefehle an flexible Geräte senden.
Voraussetzung ist, dass an den relevanten Anschlussstellen intelligente Zähler mit Kommunikationsanbindung vorhanden sind. Kurz gesagt: Die Fernsteuerbarkeit von Lasten und Erzeugern wird zur Grundbedingung, um Marktflexibilität überhaupt abrufen zu können.
Für die Beschaffung und Aktivierung von Flexibilität reicht ein reines Echtzeitbild des Netzes nicht aus. VNB benötigen vor allem verlässliche Kurzfristprognosen (nächste Minuten bis Stunden), um Engpässe frühzeitig zu erkennen und Flexibilitäten rechtzeitig auszuschreiben oder zu aktivieren.
Damit wird klar: § 14c EnWG erfordert nicht nur gute Datenverfügbarkeit, sondern auch leistungsfähige Forecasting-Modelle, die kurzfristige Entwicklungen zuverlässig abbilden. Das impliziert eine enge Integration der Messdatensysteme; moderne Datenplattformen – ggf. Erweiterungen bestehender Redispatch-2.0-Datenplattformen (wie Connect+) – bündeln die Informationsflüsse. Zudem müssen historische Daten vorliegen, um Baselines und die Wirksamkeit der Flexmaßnahmen berechnen zu können.
Die IT-Systeme des VNB müssen mit verschiedenen Akteuren kommunizieren können – sicher, standardisiert und möglichst automatisiert. Schnittstellen sind erforderlich zwischen VNB und Flex-Plattform (Ausschreibung, Gebote, Zuschläge), zwischen VNB und Anbietern/Aggregatoren (Abrufsignale, Rückmeldungen) sowie ggf. zwischen VNB und ÜNB (Abstimmung, damit z. B. eine Lastverschiebung im Verteilnetz nicht zu neuen Problemen im Übertragungsnetz führt).
Standardisierte Datenformate und Geschäftsprozesse sind hierfür notwendig. Es ist denkbar, dass die BNetzA im Zuge von § 14c-Vorgaben auch Prozess- und Schnittstellenvorgaben macht – ähnlich wie in anderen Kontexten (z. B. § 14a-Steuerung, Bilanzierungsprozesse).
Da über die IT-Infrastruktur aktiv in Anlagen eingegriffen wird, müssen hohe Sicherheitsstandards (Authentifizierung, Verschlüsselung) gewährleistet sein, um Missbrauch oder Cyberangriffe zu verhindern.
Insgesamt bauen die IT-Anforderungen auf der fortschreitenden Digitalisierung der Verteilnetze auf (Smart-Meter-Rollout, Automatisierung, Datenplattformen). VNB sollten frühzeitig die Weichen stellen, um ihre Systeme für eine künftige Flexibilitätsmarkt-Teilnahme fit zu machen, auch wenn die Regulatorik noch in der Entwicklung ist.
Aktuell (Stand August 2025) befindet sich § 14c EnWG in einer Wartephase: Die Verpflichtung ist noch ausgesetzt, und es gibt keine verbindlichen Vorgaben für VNB, außer sich auf absehbare Änderungen vorzubereiten. Allerdings laufen im Hintergrund diverse Modellprojekte und branchenseitige Aktivitäten. Branchenverbände fordern eine zügige praktische Ausgestaltung von § 14c, um Netzflexibilitäten nutzbar zu machen und Investitionssicherheit zu schaffen.
Sobald durch die BNetzA die ersten Spezifikationen genehmigt oder festgelegt sind, wird § 14c verbindlich wirksam, und VNB müssten binnen angemessener Frist ihr Beschaffungsmodell entsprechend umsetzen. Bis dahin empfiehlt es sich, die Entwicklungen genau zu verfolgen, in Pilotvorhaben Erfahrungen zu sammeln und die eigene IT/Prozess-Landschaft Schritt für Schritt auf Flexibilitätsmanagement vorzubereiten.
Jetzt einfach das Formular ausfüllen und Termin aussuchen. Erhalte umgehend eine Bestätigung per E-Mail. Bitte beachte, dass wir die Verfügbarkeit unseres Teams prüfen und uns ggf. mit einem Alternativvorschlag bei dir melden.